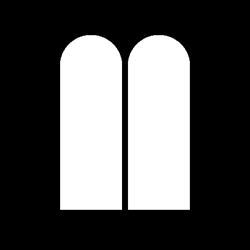Provokation
Herausforderung
„Den Reichen etwas wegzunehmen, bringt nichts. Das Ist höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein“, so wurde und wird immer erklärt, warum Umverteilung angeblich nichts bringt. Ein anderes Argument, das alle ausgleichenden Bemühungen im Keim erstickt: „Neid ist ein schlechtes Motiv.“
Die ETH Zürich und andere Institute haben recherchiert, wieviel Steuern Superreiche tatsächlich bezahlen: Es ist weit weniger als der Spitzensteuersatz, den „normal reiche“ Mittelständler durchaus begleichen. Nicht Neid, sondern Gerechtigkeit, treiben also zu einer konsequenten Besteuerung an. Und dass eine Vermögens- oder Reichensteuer nichts bringt, ist auch nicht richtig. Greenpeace hat berechnet, dass bei einer Sondersteuer für die 5.000 vermögendsten Personen 200 Milliarden herausspringen würden.
Einfacher ist es natürlich, das Bürgergeld zu kürzen und mit anderen sozialen Leistungen ein paar Milliarden einzusparen. Währenddessen steigen die Vermögen der Superreichen weiter. Und diese Vermögen geben ihnen die Möglichkeit, Einfluss auf die Meinungsbildung zu nehmen und weiter die Narrative zu pflegen, die besagen, dass es nichts bringt ... (siehe oben!)
Quellen: WirtschaftsWoche, Lisa Ksienrzyk 19.04.2024. epd 6.12.24. @mondschaf23 6.12.24
Georg Rieger
Thomas Gottschalk gibt sich gerne als etwas unbedarft. Was meint, dass er gerne so reden will, wie ihm der Schnabel gewachsen ist – ohne viel nachzudenken. Eingeschlossen Bemerkungen, die sexistisch oder rassistisch sind. Er würde wohl sagen: die sexistisch oder rassistisch aufgefasst werden wollen.
Diese Schuldumkehr ist das eigentliche Problem. Seit seiner letzten Sendung betreibt er diese – und zuletzt durch ein ganzes Buch, in dem er beklagt, dass er nicht mehr „Ungefiltert“ (so der Titel) reden darf.
In einem Interview fügte Gottschalk jüngst hinzu, dass er es nicht genießt, „angepinkelt“ zu werden. Mitunter hat man das Gefühl, dass doch. Denn Tommy hätte sich einfach in den Ruhestand verabschieden können und alle hätten seine Sprüche und seine Tätscheleien als ein Phänomen einer vergangenen Zeit verbucht.
Weil ihm die Aufmerksamkeit wichtiger ist, macht er sich zunehmend lächerlich. Dabei kann er durchaus sympathisch selbstironisch sein – wie am Ende seines Buches: "Hier schreibt sich einer seinen Frust von der Seele, der in Wirklichkeit damit hadert, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war, und der klagt, dass er nicht mehr das ist, was er mal war."
Quelle: Treads selinakristin (24.10.24)
Georg Rieger
Anfang des Jahres gab es gut besuchte und ermutigende Demonstrationen gegen rechtsradikale, verfassungsfeindliche und menschenfeindliche Parolen. Nun hat der Bundestag mit den Stimmen der Ampel-Koalition ein „Sicherheitspaket“ beschlossen, das Wasser auf die Mühlen genau dieser Erzählungen ist, dass Geflüchtete Deutschland bedrohen und sie deshalb so schlecht wie möglich behandelt werden müssen.
Die beschlossenen Maßnahmen gehen so weit, dass Menschen, die laut dem Dublin-Abkommen eigentlich in einem anderen EU-Land sein müssten, jegliche Sozialleistungen entzogen werden, sie also Hunger und Obdachlosigkeit – letztlich auch der Gewalt der Straße – ausgesetzt werden. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Verfassungsgebot, die Würde des Menschen zu schützen.
Gehen wir jetzt wieder auf die Straße? Das wird wohl kaum passieren, weil sich die Debatte binnen eines halben Jahres so verschoben hat, dass sich kaum mehr jemand öffentlich für den Schutz von Geflüchteten einsetzt. Es war leider nur ein kurzes Aufflammen von Mitmenschlichkeit und Integrationsbereitschaft. Die Lügen und der Hass sind längst mehrheitsfähig.Georg Rieger
Ralf Stegner wurde bei der Friedensdemo am 3. Oktober in Berlin ausgebuht, als er vom "russischen Angriffskrieg" sprach. Die gebuht haben, sehen es wohl als pazifistisch an, Aggressoren nicht mehr als solche zu bezeichnen.
Pazifismus ist – ähnlich wie Gerechtigkeit und Freiheit – für manche ein Ideal, für andere eine Lösung. Der Ansatz ist aber in keinem Fall, Gewalt zu verharmlosen, sondern ihr mit anderen Mitteln zu begegnen.
Eine Alternative zum Gegenhalten mit Waffen ist der gewaltlose Widerstand. Dieser erfordert Vorbereitung, ein hohes Maß an Zusammenhalt, Solidarität und Bereitschaft zum Leiden. Das von Anderen zu verlangen, ist zumindest schwierig. Vor allem dann, wenn man sich selbst mit dieser Idee nicht einmal im Ansatz beschäftigt. In der Friedensbewegung der 80er Jahre wurde viel darüber diskutiert. Derzeit ist davon nichts zu hören. Aber vielleicht deshalb, weil es genau an den genannten Voraussetzungen fehlt.
Georg Rieger RefApp
Leider schon wieder er: Friedrich Merz nennt beim CDU-Parteitag in Münster Robert Habeck einen „Kinderbuchautor“. Soweit erstmal richtig. Tatsächlich hat Habeck zusammen mit seiner Frau Andrea Pauch unter anderem fünf Kinderbücher veröffentlicht. Allerdings auch Übersetzungen englischer Lyrik und anspruchsvolle Romane und Theaterstücke.
Gemeint war das natürlich nicht respektvoll. Schlimmer als die Geringschätzung eines Berufsstandes ist, dass diese verkürzte Bezeichnung eine typische aus der rechtsradikalen Szene ist. AfD-Politiker benutzen den „Kinderbuchautor“ teilweise ohne Namensnennung.
Dieses Nachäffen rechter Rhetorik und die damit einhergehende Normalisierung von Respektlosigkeit gefährden den politischen Diskurs und damit die Demokratie. Heino wünscht sich einen deutschen Trump und schwarzbraun ist die Haselnuss. Dsa darf doch alles nicht wahr sein!Georg Rieger
Ja, es sollte in Deutschland der Notstand ausgerufen werden. Allerdings aus einem anderen Grund als von Friedrich Merz vorgeschlagen hat. Es herrscht ein akuter Bildungsnotstand im Bereich der Mathematik. Selbst das Känguru von Marc Uwe Kling kann es besser: Die alarmierende Zahl, die uns dazu bewegen soll, die Grenzen zu schließen und die Idee vom Europa der offenen Grenzen zu begraben: 20 So viele Opfer islamistischer Gewalt gab es seit dem Jahr 2000 – also in 24 Jahren! Zum Vergleich: Jedes Jahr sterben hunderte Menschen (2023: 665) durch überhöhte Geschwindigkeit. Ein Tempolimit gibt es aber nicht.
Der Vergleich von Todesopfern verbietet sich eigentlich, weil jeder Fall eine Tragödie ist. Und die Gefahr durch islamistischen Terror soll auch gar nicht kleingeredet werden. Doch Millionen Menschen in unserem Land oder auf der Flucht hierher pauschal zu beschuldigen, hat keinen rational nachvollziehbaren Grund, sondern lenkt von den wahren Problemen ab. Und es spielt denen in die Karten, die unsere Demokratie durch das Schüren von Ängsten zerstören wollen.
Marc Uwe Kling, Nationaler Notstand: https://www.youtube.com/watch?v=ekxkveEnE2k
Georg Rieger, Nürnberg
Der Comedian Luke Mockridge hat sich für seine Witze über die Paralympics entschuldigt. Er habe eigentlich höchsten Respekt vor den Leistungen der behinderten Sportler*innen. Es bleibt die Frage, warum jemand – insbesondere mit seiner Reichweite – zutiefst verletzende Sprüche für witzig hält.
Überhaupt nicht einsichtig zeigen sich die Hosts des Podcasts „Die Deutschen“, Nizar Akremi und Shayan Garcia. Sie werfen ihren Kritiker*innen „Cancel Culture“ vor – insbesondere der zweifachen Olympiasiegerin Kristina Vogel, die alles ins Rollen gebradht hat. Es gehe ihr nur um Aufmerksamkeit für ihr Buch, sagen Akremi und Garcia.
Nun bekommt Kristina Vogel in den sozialen Medien den gesammelten Hass derer ab, die vorgeben, für die Meinungsfreiheit zu kämpfen. Auch Todesdrohungen gegen die behinderte Sportlerin sind darunter.
In Kommentaren geht es immer wieder um die Frage, ob denn überhaupt noch über irgendetwas gelacht werden dürfe. Die traurigste Form des Humors ist die verletzende. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Nicht zur Ansicht empfohlen: https://www.brisant.de/stars/luke-mockridge-paralympics-122.html
Georg Rieger, Nürnberg
Wie sinnvoll ist es, mit Menschen zu diskutieren, die eine menschenfeindliche Haltung an den Tag legen. Oder gar offen faschistische Ideen propagieren. Dazu gehört zum Beispiel die völkische Idee von der unterschiedlichen Wertigkeit von Menschen deutscher und anderer Herkunft.
Ist das noch Protest gegen eine Benachteiligung durch die gesellschaftlichen Umstände oder die Chancen-Ungleichheit im wirtschaftlichen System? Der als Komiker nicht hinreichend beschriebene Hape Kerkeling hat dazu gepostet: „Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass Faschismus jemals durch Diskussion beendet wurde.“
Kerkeling hält viele Menschen, die solchen Ideen anhängen, für ansprechbar. Diejenigen, die sie offensiv vertreten, aber nicht. Da scheitern alle rhetorischen Mittel. „Wenn Ihr Gegner glaubt, dass Schwarz Rot ist, dann haben Sie verloren.“
Und Kerkeling weiter: „Wir haben gesehen, wie wir [1933] in diese Katastrophe gerutscht sind. Daraus müssen wir dringend Lehren ziehen. Es sollte doch heute vermeidbar sein, rechte überhaupt erst an die Macht zu lassen. Ich hoffe inständig, wir haben aus der Geschichte gelernt und erwehren uns, bevor es zu spät ist.“
Quelle: t-online, Interview mit Hape Kerkeling am 8.3.24 (Steven Sowa)
Georg Rieger, Nürnberg
Die BILD-Zeitung hetzt in ihrer Ausgabe vom 29. August gegen eine Anwältin, die Flüchtlingen zu ihrem Recht verhilft. Vor dem Hintergrund des Attentats von Solingen soll das als eine Art Beihilfe zum Mord geframed werden.
So könnte es bald auch Kirchengemeinden gehen, die sich für Geflüchtete einsetzen – durch Kirchenasyl oder Integrationshilfe. Dieses Gutmenschentum sei naiv und spiele den Terroristen in die Karten. So ist es jetzt schon zuweilen vernehmbar.
Genau das Gegenteil ist der Fall: Jede mitmenschliche Aktion und jede gelungene Integration ist den Islamisten ein Dorn im Auge. Sie reden den Muslimen hier ein, dass sie sich in Europa in feindlicher Umgebung befinden. Je frustrierter Menschen sind, desto besser greift dieses Narrativ. Deshalb sind Menschenfreundlichkeit und Integration geeignete Mittel, um Islamisten das Wasser abzugraben.
Natürlich auch andere Maßnahmen, z.B. die Früherkennung von Radikalisierung und das Einwirken auf muslimische Verbände. Dazu zwei informative Podcasts:
Tag für Tag (DLF): Murat Kayman, Attetat in Solingen - Publizist: Reaktion muslimischer Organisationen kontraproduktiv.
Politik mit Anne Will: Wie werden Menschen zu Terroristen? Mit Peter R. Neumann
Georg Rieger RefApp
Die amerikanische Forscherin Eunice Newton Foote war die erste, die den Zusammenhang von CO2-Konzentration und Erderwärmung nachwies – und zwar im Jahr 1856! Sie untersuchte das Verhalten unterschiedlicher Gase unter Sonneneinstrahlung. Das Gas, das sich am stärksten erwärmte, war der Kohlenwasserstoff. Damit war das beschrieben, was wir heute „Treibhauseffekt“ nennen.
Ihre Erkenntnis darf sie bei der Jahrestagung der American Association of the Advancement of Science nicht selbst vorstellen, sondern muss das einem Mann überlassen. Und nach der Tagung gehen Footes Erkenntnisse verloren. Erst 2010 werden sie wiederentdeckt und gewürdigt.
Quelle: Der Rest ist Geschichte (Podcast des Deutschlandfunks), Folge: Klima und Krise – Seit wann wir von der Erderwärmung wissen (ab 12:36)
Georg Rieger, Nürnberg