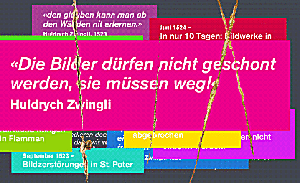Bildersturm – Protest gegen eine Kultur der Unfreiheit
Die reformierten Protestanten und die Bilder der Macht
Die "reformierte" Reformation, die im 16. Jahrhundert in der Schweiz ihren Anfang nahm, begann oft mit einer Art "Bildersturm". So wurden 1523 in Zürich all die Statuen, die Heiligenfiguren und Bilder, die sich damals in großen Mengen in den Kirchen befanden, mehr oder weniger geordnet entfernt, manche allerdings auch zerschlagen oder verbrannt. Vergleichbares ereignete sich auch in anderen Regionen der Schweiz und in den Freien Reichsstädten Süddeutschlands. Und die Kirchbauten, die nach der Reformation in reformierten Gemeinden nicht nur der Schweiz entstanden, verzichten in der Regel ganz auf bildlichen Schmuck.
Als "Auswuchs der Reformation" bezeichnen den damaligen "Bildersturm" manche heute, als Taten religiöser Eiferer, durch die kostbare Kunstwerke der Nachwelt verloren gegangen sind. Und sicher ist das aus heutiger Sicht richtig: dass vieles zerstört wurde, was wir heute als bedeutendes Kulturgut bezeichnen würden. Die Reformierten von damals, könnten wir sie befragen und hätten wir ihnen erläutert, was wir unter "Kultur" und "Kulturgut" verstehen, würden vielleicht sogar zustimmen. In der Tat ging es um die Zerstörung von "Kultur". Sie würden dann aber auch darauf hinweisen, welche "Kultur" sie treffen wollten, was denn warum zerstört werden sollte mit den Bildern und Heiligenfiguren.
Ein Sturm gegen Herrschaft und Unmündigkeit
Wir bewundern – an einer Heiligenfigur etwa – vielleicht die Ästhetik. Oder wir erkennen aus ihrer Gestaltung etwas über die Verhältnisse der Zeit ihrer Entstehung. Die Menschen damals haben die mit der Figur verbundene Frömmigkeit erlebt. Sie haben die Folgen der in ihr repräsentierten Machtverhältnisse am eigenen Leibe erlitten. Denn in den Gottesdiensten waren sie angewiesen auf ein Verständnis der Bibel, wie es ihnen die Bilder vorgaben. Das war orientiert an einem die Macht der Kirche sanktionierenden Herrschergott. Und in den Bildern und Statuen waren zudem die reichen und mächtigen "Herren" ihrer Zeit als deren Stifter ständig gegenwärtig, zum Teil auch in bildlicher Darstellung. Die Zerstörung einer Heiligenfigur hieß dann auch: Keine Frömmigkeit, die uns als unmündige Untertanen der Kirche und eines Herrschergottes festlegt. Keine Ausgestaltung der Kirchen, in deren Prunk sich mit den Stiftern die gesellschaftlichen Machtverhältnisse spiegeln und die zu Lasten der Armen geht. Der "Bildersturm" damals galt damit sowohl der Festlegung Gottes als auch der Menschen in einem autokratischen Herrschaftssystem, galt der Manifestation der bestehenden Frömmigkeits- und Machtverhältnisse in Kirche und Gesellschaft.
Rückhalt im Zweiten Gebot
Rückhalt fanden die Reformierten damals in der Bibel. In der biblischen Zählung der zehn Gebote heißt das zweite Gebote: "Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der Herr, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten." (2. Mose 20, 4-6)
Eine "reformierte" Theologie, die auf einer neuen Auslegung der Bibel gründete, fanden die Reformierten dann weniger bei Martin Luther als bei Theologen wie Ulrich Zwingli (1484-1531) und Johannes Calvin (1509-1564). Deren Auslegung des zweiten Gebots ging es im wesentlichen um die Unverfügbarkeit Gottes. Sie sahen die Gefahr, dass die Bilder Gott gewissermaßen ersetzten. "So nehmen aber die Bilder und sichtbaren Dinge bei uns mehr und mehr zu und werden größer und größer, bis dass man sie zuletzt für heilig hält und bei ihnen anhebt, das zu suchen, was man allein bei dem wahren Gott suchen soll." (Zwingli) Ihre Auslegung zielt, modern gesprochen, auf die Freiheit und Lebendigkeit Gottes und auf sein Verhalten zu den Menschen. Er soll nicht in einem Bilde festgelegt werden; es geht auch nicht darum, wie er "ist".
Wider die Funktionalisierung von Bildern
Nun war und ist deutlich, dass Rede von Gott (und den Menschen!) ohne Bilder nicht auskommt, mindestens ohne Sprachbilder nicht. Dem zweiten Gebot geht es im Kern auch nicht um das Verbot jeglichen Bildes. Es zielt auf die Funktionalisierung von Bildern und deren Repräsentanz, wenn man so will: Macht, die ihnen dadurch zukommt. In diesem Zusammenhang war der Einspruch der Reformatoren der gegen die Festlegung auf ein Bild und ihre Funktionalisierung im Interesse der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Nur eine Vielzahl von Bildern, wie sie etwa als Sprachbilder in der Bibel vorliegen, vermag etwas zu spiegeln von dem, wie sich Gott den Menschen gegenüber verhält.
Diese "neue" Auslegung des zweiten Gebotes hatte damit immer auch eine soziale Komponente. Es ging darum, dass das für die Ausgestaltung der Kirchen aufgewendete Vermögen, auch das der Stifter, besser für die Armen auszugeben sei. Auch das wird in den Äußerungen der Reformatoren deutlich heraus gestellt.
Dieses Verständnis des zweiten Gebotes war in der Folgezeit Gestaltungsprinzip reformierter Kirchen. Wo neue Kirchbauten entstanden, waren sie als Versammlungsraum für die Gemeinde konzipiert. Keine Bilder, in der Regel auch kein Kreuz, kein "Altar" sind zu finden. Die Bankreihen bzw. die Bestuhlung sind oft auf die Kanzel und den Abendmahlstisch hin orientiert. Dort geschieht das Entscheidende, das Predigen des Wortes, die Feier der spirituellen Abendmahls-Gemeinschaft mit Christus. Bis heute sind Kirchen in reformierten Gemeinden durch dieses Raumkonzept deutlich von anderen zu unterscheiden.
Bilder, die wir uns von Gott machen
Dieses Verständnis des zweiten Gebotes hat dann auch Rückwirkung auf die Bilder, die wir uns von Gott machen, etwa in der Festlegung als männlich oder weiblich. Angesichts seiner Ebenbilder in der versammelten Gemeinde ist Offenheit angesagt. Und es macht dann allemal Sinn, vorsichtiger davon zu reden, dass Gott wie ein Vater, wie eine Mutter oder auch wie eine Henne, wie ein König (alles biblische Bilder) handelt, ohne Aussagen über ihn in seinem Sein treffen zu wollen.
Und wie Gott nicht festgelegt werden kann in einem Bild, so können es auch seine Ebenbilder nicht. Die Auslegung des zweiten Gebotes zielt somit auch auf die Freiheit und Lebendigkeit der Menschen. Das haben die "Bilderstürmer" mit ihrem Protest gegen die in den Bildern aufscheinenden und repräsentierten Machtverhältnisse deutlich gemacht. Die Erinnerung des zweiten Gebotes in dieser Perspektive stellt gewissermaßen die "Machtfrage": wer in welchem Interesse das Bild oder die Bilder vom Menschen bestimmt. Denn nur auf den ersten Blick mag es scheinen, dass das multi-mediale Zeitalter die Pluralität der Menschen-Bilder garantiert.
Ein näherer Blick bestätigt eher die Dominanz bestimmter Bilder, etwa das des modernen, flexiblen, jung-dynamischen und natürlich kauffähigen und -freudigen Menschen, den die Werbung uns nach wie vor vorspielt. Oder das bestimmter Männer- und Frauenrollen, die je nach gesellschaftlichen Anforderungen changieren. Oder das von "Gesundheit", wie sie etwa in der Debatte um die Gentechnologie erkennbar wird. Die Erinnerung des zweiten Gebotes ist dann der Einspruch gegen multi-mediale Festlegung des Bildes des Menschen und damit des Menschen selbst. Wie erst die Pluralität der Bilder sinnvolle Aussagen über Gottes Handeln zulässt, so die Pluralität der Menschen-Bilder über den Menschen.
Der drastische Einspruch der "reformierten" Reformatoren zielte auf eine bestimmte Kultur und hat sicher auch bedeutende Kulturgüter zerstört. Es war der Protest gegen eine Kultur der Unfreiheit – Gottes wie der Menschen. Diesen Protest zu erinnern und zu verlebendigen bleibt gegenwärtige Aufgabe, nicht nur der reformierten Christinnen und Christen.
Jörg Schmidt
Ein altes jüdisches Gesetz wird von den Reformierten hoch gehalten und erweist immer wieder seine Aktualität.